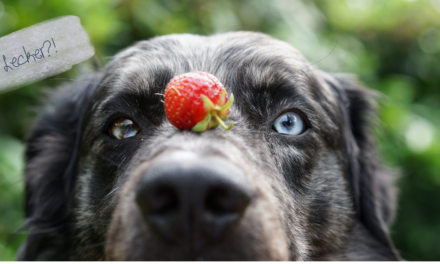Als Grundhaltung wird unsere Einstellung uns selbst und unserer Umwelt gegenüber bezeichnet. Es hängt von unserer Grundhaltung ab, auf welche Art und Weise wir mit unserer Umwelt umgehen, sie bestimmt also unsere Handlungen. Im pädagogischen Sinne bezeichnet Grundhaltung die Einstellung, aus der heraus wir unseren Weg im Umgang mit unseren Schutzbefohlenen – und so auch mit unseren Hunden – wählen.
Unser Denken bestimmt unsere Handlungen
Grundlage unseres Denkens ist neben unserem Wissen und unserer Erfahrung bezüglich eines bestimmten Themas stets auch unser Inneres, unser „Selbst“. Die Erfahrungen unserer Kindheit, unsere Kultur, die Gesellschaft, in der wir leben, die Menschen um uns herum und ihre Lebenseinstellung, all das trägt zu dem bei, was uns letztendlich ausmacht.
Wir greifen also nicht nur auf verschiedene Wissensbestände und Theorien zu, die unsere Annahmen stützen, sondern es kommen immer noch unsere ureigenen persönlichen Erfahrungen und Glaubenssätze hinzu.
Des Weiteren spielen in unsere Sichtweise natürlich auch immer unsere eigenen Emotionen hinein: Erfüllte und unerfüllte Bedürfnisse, alte Gedankenmuster, uralte Gefühle, die in unserem „Mensch sein“ mitschwingen. All das gilt es zu erforschen: Was davon ist „Meins“, was „mein Gegenüber“, was „jetzt“, was „Vergangenheit“?
Wir sehen nur, was wir bereits wissen
… oder: Jede Objektivität ist subjektiv
Einer meiner Lieblingsdozenten in der Uni sagte einmal „Wir sehen sowieso nur das, was wir bereits wissen!“ Unser Gehirn versucht beim Aufnehmen von Außenreizen, die für uns wichtigen Informationen herauszufiltern und diese dann gleich mit bereits vorhandenen Wissensbeständen / Grundlagen in Verbindung zu bringen. Es zieht sozusagen unsere Schubladen raus und sortiert Dinge zusammen, die scheinbar zusammen gehören.
Wenn wir zum Beispiel einen Hund sehen, der den Menschen anknurrt, weil dieser seinem Knochen zu nahe kommt, und uns als erstes die Rangordnungstheorie einfällt, werden wir unsere Beobachtung mit dieser erklären, um zu verstehen, was vor sich geht.
Unser Gehirn filtert gleichzeitig alle Details, welche ihm nicht wichtig erscheinen – weil wir nichts darüber wissen und es keine dementsprechende Schublade gibt – als „uninteressant, wird nicht mehr benötigt“ aus. Wenn wir aber nur einen einzigen Erklärungsansatz kennen, dann ist das so, als würden wir immer im selben Supermarkt einkaufen und nur dessen Angebot kennen. Wir wissen dann zwar, dass unser Supermarkt A Äpfel verkauft, nicht aber, ob es die besten Äpfel sind, die wir bekommen könnten.
Informieren wir uns jedoch zusätzlich über die Apfelangebote von Supermarkt B, C und D, können wir diese vergleichen und uns eine fundierte Meinung bilden. Die Entscheidung, welche Äpfel nun die besten sind, bleibt subjektiv, richtet sich danach, welche Äpfel wir persönlich lecker finden. Womöglich kaufen wir weiterhin nur in Supermarkt A, aber der Filter der Supermarktleitung „diese Äpfel sind die besten!“ entfällt und wir haben uns ein eigenes Urteil gebildet.
In unserem Hundebeispiel könnten wir A (Rangordnungstheorie) andere Erklärungsansätze wie B (Ressourcenaggression), C (körpersprachliche Kommunikation des Hundes), D (Vorgeschichte dieses Hundes) etc. gegenüberstellen und auf dieser Basis entscheiden, was uns im konkreten Fall zutreffend und bedeutsam erscheint. Der Filter, durch den wir die Situation ursprünglich betrachtet haben, bestimmt unsere Sicht nicht mehr ausschließlich und wir werden möglicherweise etwas vollkommen anderes sehen können. Nun können wir entscheiden, ob wir bei unserer ursprünglichen Meinung bleiben, oder diese revidieren wollen.
Diese Entscheidung allerdings wird – wie bereits erläutert – nicht nur von A,B,C und D, sondern stets auch von unserem „Selbst“ beeinflusst.
Wichtig ist dabei, möglichst wenig „vorgefiltertes“ Wissen zu nutzen, also darauf zu achten, dass nicht jemand seinen „Stempel“ auf das Wissen drückt und aus seiner eigenen Perspektive erklärt. Das passiert zum Beispiel dann, wenn jemand das Verhalten eines Hundes auf Basis der Erfahrungen mit dem eigenen Hund (also mit einem persönlichen Filter) so erklärt, als handele es sich dabei um eine allgemeingültige Erkenntnis – womöglich ohne den konkreten Fall genau zu kennen. Je mehr wir uns also den Originalquellen (Fachliteratur, Studien etc.) nähern, desto objektiver können wir ein Thema betrachten.
Auf dieser Basis betrachten wir die Situation zwar immer noch durch den Filter unserer eigenen Wahrnehmung, wir haben jedoch alles dafür getan, unsere Subjektivität so objektiv wie möglich zu gestalten, und können andere Optionen in Betracht ziehen. Im konkreten Fall zum Beispiel, dass der Hund nicht in der Rangordnung aufsteigen will, sondern die Erfahrung machten musste, dass der Mensch ihm Ressourcen wegnimmt.
Was das für unsere Handlungen bedeutet
Unsere Handlungsideen, unsere Vorstellungen davon, was am Besten zu tun sei, entstehen aus unseren Betrachtungen: aus dem, was wir zu beobachten meinen. Was passiert nun, wenn wir einen Hund zu sehen meinen, der uns zeigen will, dass er der Boss ist?
Nicht umsonst wird der Halter eines Hundes „Herrchen“ genannt – der Mensch ist Herr über seinen Hund. „Herr der Lage zu sein“ empfinden wir als Kompliment. Gleichzeitig haben wir gelernt, Herrschenden Respekt zu zollen. Oder wir haben als Kinder selbst Respekt „eingebläut“ bekommen.
Wir neigen dazu, Respekt mit Unterordnung / Unterwürfigkeit zu verwechseln. Ihn als etwas zu betrachten, das wir uns nicht etwa verdienen müssen, sondern einfordern und durchsetzen können, ja müssen.
Ein Hund, der uns diesen „Respekt“ verweigert, unsere „Herrschaft“ nicht anerkennt, bringt uns in einen Handlungszwang: Wir müssen uns durchsetzen! Wir empfinden es als notwendig, uns durchzusetzen, Respekt einzufordern, weil wir selbst genau das haben lernen und verinnerlichen müssen.
Ganz platt gesagt: Wir spielen Mama / Papa und Kind … mit unserem Hund in der Rolle des Kindes. Und womöglich werden wir am Beispiel unseres Hundes reinszenieren, also ein weiteres Mal wiederholen, was uns selbst widerfahren ist, damit wir „Respekt“ entwickelten, uns unterzuordnen lernten.
Als Kinder waren wir den Reaktionen unserer Eltern auf ein etwaiges Fehlverhalten hilflos ausgeliefert, wir waren überwältigt davon – deswegen neigen wir dazu, unerwünschtes Verhalten ebenfalls auf eine Art und Weise zu sanktionieren, die überwältigend wirkt: So haben wir das gelernt. So haben unsere Eltern das gemacht – so ist es richtig.
Gleichzeitig geraten wir unter Druck, schnell handeln zu müssen: Das dürfen wir unserem Hund keinesfalls durchgehen lassen, das müssen wir umgehend unterbinden! Strafmaßnahmen wie der sogenannte Alphawurf (den Hund gewaltsam auf den Rücken drehen und festhalten, bis er aufgibt) oder aber „Rangreduktionsmaßnahmen“ (Entzug von sogenannten Privilegien wie Zugang zu Ressourcen, Bewegungsfreiheit, Aufmerksamkeit …) erscheinen dann als probate, unkompliziert umzusetzende Mittel. „Runter vom Sofa!“, aber auch „der Mensch geht immer voran!“ oder „bevor der Hund fressen darf, isst der Mensch!“ sind vergleichsweise leicht „durchzusetzen“ und geben uns das gute Gefühl, das unsere getan zu haben.
Können wir stattdessen einen Hund sehen, der die Erfahrung gemacht hat, dass ihm Ressourcen streitig gemacht werden, der sich vielleicht selbst versorgen musste und gehungert hat, der also – aus seiner Sicht – um sein Überleben kämpft, tappen wir weder in die Falle unserer eigenen Erfahrungen und Emotionen, noch geraten wir in einen Handlungszwang.
Wir haben eine andere, distanziertere Sich auf die Situation: Welches Verhalten zeigt der Hund? Was hat das Verhalten ausgelöst? Welche Funktion könnte sein Verhalten haben? Welche Emotionen stecken womöglich dahinter? Aus dieser Sicht heraus kann unsere eigene Reaktion sehr viel milder und angemessener ausfallen: Wir müssen uns nicht durchsetzen, sondern sind offen für andere Lösungswege und können zum Beispiel ein Tauschgeschäft anbieten.
Reflexion als Schlüssel zur Entfaltung der Grundhaltung
Obwohl unsere Grundhaltung schon in der Kindheit entsteht, ist sie nicht in Beton gegossen, sondern kann sich durch neue Erkenntnisse und Überzeugungen weiterentwickeln. Dazu können wir Selbstreflexion, also das Nachdenken über uns selbst bzw. unser Verhalten nutzen.
Haben wir den Eindruck, auf einem guten Weg zu sein? Wie fühlen wir uns auf diesem Weg?
Wir können fragen, ob wirklich zutrifft, was wir zu wissen glauben, ob unsere Ideen, wie wir handeln können, uns tatsächlich weiterhelfen. Spätestens dann, wenn wir uns unwohl fühlen, weil wir zum Beispiel einen Fehler gemacht haben, setzen solche Gedanken ganz von selbst ein. Anstatt uns nun aber Vorwürfe zu machen, können wir diese Momente als Chance nutzen.
Wir können uns fragen, warum wir diesen Fehler gemacht haben: Waren wir überfordert, weil wir schnell handeln mussten? Haben wir die Situation falsch eingeschätzt? Sind wir in Verhaltensweisen „zurückgefallen“, von denen wir uns trennen wollten? Aus welcher Emotion heraus, in welchem Glauben haben wir gehandelt?
Was hätten wir stattdessen tun können?
Unter welchen Bedingungen hätten wir uns anders verhalten können?
Aber auch: Um wen ging es? Ging es um unser Ego (war zum Beispiel das Verhalten unseres Hundes uns peinlich, während er gar kein Problem hatte?), oder haben wir gehandelt, um eine Gefahr abzuwenden oder unseren Hund zu unterstützen?
Regelmäßig zu reflektieren, kann uns dabei helfen, unser eigenes Handeln zu verstehen und es immer wieder mit unserer Grundhaltung in Verbindung zu bringen, mit unserer Idee davon, wie es sein könnte oder sollte.
Auf diese Art und Weise bleiben unser Wissen und Denken in Bewegung, verändern sich und entwickeln sich weiter. Wir können ganz offen dazu stehen „auf dem Weg zu sein“. Wir müssen nirgendwo ankommen: Da unsere Wahrnehmung immer begrenzt sein wird und wir niemals alles wissen werden, können wir das auch gar nicht.
Wir sind auf dem Weg. Und der Weg ist das Ziel.
Foto © siloto via canva.com